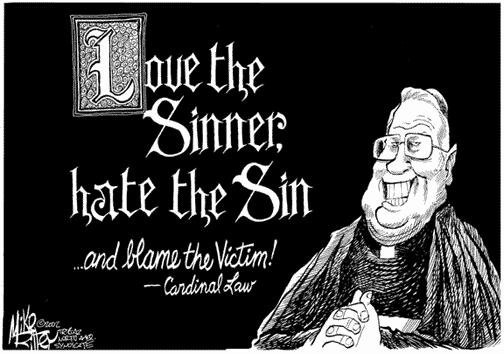Ärzte Zeitung.de 22.10.2012
Jörg Fegert ist Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie der Universität Ulm. Fegert ist Mediziner und Soziologe.
Stolperfallen bei der Behandlung von Missbrauchsopfern: Die
Anfragen von Kassen nach den Tätern bringen Ärzte in Gewissenskonflikte,
kritisiert der Ulmer Psychiater Professor Jörg Fegert.
Jetzt will er
sich von einer Kasse verklagen lassen.
Ärzte Zeitung.de 22.10.2012
Jörg Fegert ist Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie der Universität Ulm. Fegert ist Mediziner und Soziologe.
Stolperfallen bei der Behandlung von Missbrauchsopfern: Die
Anfragen von Kassen nach den Tätern bringen Ärzte in Gewissenskonflikte,
kritisiert der Ulmer Psychiater Professor Jörg Fegert.
Jetzt will er
sich von einer Kasse verklagen lassen.
Ärzte Zeitung: Herr Professor Fegert, warum wollen Sie sich von einer Krankenkasse verklagen lassen?
Professor Fegert: Natürlich wünscht man sich als Klinikdirektor eigentlich keine rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Kostenträgern.
Wir Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten, aber auch
viele Fachärzte in der Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik oder auch
die psychologischen Psychotherapeuten bemerken aber zunehmend, dass die
Kostenträger, wenn Diagnosen wie posttraumatische Belastungsstörung
gestellt werden, automatisch an die Ärzte und Therapeuten Anfragen
stellen, Hinweise zum möglichen Täter oder Verursacher zu geben.
Ärzte Zeitung: Kann man ihnen das verdenken?
Fegert: Diese Anfragen sind deshalb in der klinischen Praxis
äußerst problematisch, weil die Krankenkassen, um den Täter zu finden,
sich eigentlich nur auf die Ermittlungstätigkeit der
Staatsanwaltschaften stützen können.
Viele Opfer von Gewalttaten, auch bei häuslicher Gewalt, viele
Betroffene von sexuellem Missbrauch sind aber zum Zeitpunkt, wo sie sich
erstmals in Krankenbehandlung geben, weder willens noch in der Lage,
Strafanzeige zu stellen und die Folgen auf sich zu nehmen.
Sie erschreckt die Vorstellung, dass Krankenbehandlung oder
Psychotherapie mit diesem Vorgehen der Krankenkassen verbunden werden.
Ärzte Zeitung: Üben die Kassen Druck aus?
Fegert: Wir haben im stationären Bereich sehr schlechte
Erfahrungen gemacht. Diese Schreiben werden den Patientinnen direkt ans
Krankenbett zugestellt. Das hat schon Panikreaktionen bis hin zu
suizidalem Verhalten ausgelöst.
Deshalb bin ich aus meiner ethischen Verantwortung für die Patienten
heraus nicht bereit, diese Anfragen zu beantworten, obwohl ich
gesetzlich dazu verpflichtet bin. Dies führt oft zu langem
Schriftwechsel mit den Kostenträgern.
Nun hat ein Kostenträger den Weg direkt über meine Klinikverwaltung
gewählt, um doch noch an diese Information zu gelangen, obwohl ich die
Herausgabe ärztlich nicht verantworten kann.
In diesem Fall wünsche ich mir fast, dass die Krankenkasse versucht, mich mit rechtlichen Mitteln zur Herausgabe zu zwingen.
Ärzte Zeitung: Was versprechen Sie sich davon?
Fegert: In diesem Fall könnte man dann klären lassen, ob die
grundrechtlichen Garantien für körperliche Unversehrtheit nicht vor die
prinzipiell berechtigten Ansprüche zur Refinanzierung fremdverursachter
Gesundheitsschäden der Kassen gehen.
Ärzte Zeitung: Schildern Sie doch einmal einen konkreten Fall.
Fegert: Typisch ist, dass ein Mädchen nach einem Suizidversuch
mit Symptomen einer schweren Depression aufgenommen wird. Im Laufe der
ersten Gespräche stellt sich heraus, dass es durch ein Familienmitglied
sexuell missbraucht wird.
Es mag den Mann eigentlich, will aber, dass es aufhört, es will die
Beziehung der Mutter nicht gefährden, will geschützt werden, ist völlig
verzweifelt. Eine Strafanzeige gegen den Mann kann sich das Mädchen
nicht vorstellen.
Sie zeigt immer mehr Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Diese Diagnose wird gestellt.
Daraufhin schickt die Krankenkasse ein Schreiben mit ungefähr dem
Wortlaut: "Uns liegen Hinweise darauf vor, dass bei der Patientin ein
drittverursachter Gesundheitsschaden zu vermuten ist. Sie sind als an
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Arzt beziehungsweise als
Krankenhaus nach Paragraf 108 verpflichtet, die erforderlichen Daten,
einschließlich der Angaben über Ursachen und den möglichen Verursacher,
der Krankenkasse mitzuteilen. Bitte machen Sie entsprechende Angaben."
In diesen Fällen versuche ich dann höflich zu begründen warum dies
für die Patientin eine aus meiner Sicht nicht verantwortbare Belastung
darstellen würde. Denn oftmals dauern solche Vorgänge auch administrativ
relativ lange, das heißt, das betreffende Mädchen kann schon mehrere
Wochen aus der akuten stationären Behandlung entlassen sein.
Erst dann taucht plötzlich die Staatsanwaltschaft in der Familie auf,
ohne dass jemand damit rechnet. Wir müssten die Patientin also über die
Weitergabe der Daten informieren. Dies führt meist zu einer starken
Beunruhigung und Belastung und dem Wunsch, dies bitte, bitte nicht zu
tun.
Häufig reagieren Krankenkassen auf meine Schreiben gar nicht, sondern
man versucht es direkt bei den Versicherten, oder wie in dem bereits
geschilderten Fall bei der Klinikverwaltung.
Ärzte Zeitung: Sind Ärzte wirklich verpflichtet, Hinweise auf mögliche Täter zu geben?
Fegert: Nach dem geltenden Recht im Sozialgesetzbuch V
ausdrücklich ja. Bei dem jüngsten Hearing des Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Missbrauchs in Berlin haben viele Fachkollegen
aus ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, zum Beispiel der
Kinderheilkunde, der Erwachsenenpsychosomatik und niedergelassene
Psychotherapeutinnen sich dafür eingesetzt, dass sich dringend etwas
ändern muss.
Der Gesetzgeber müsste der an sich sinnvollen Norm, die zum Beispiel
dafür sorgt, dass bei einem Schulunfall nicht die Krankenkasse belastet
wird, sondern die Schulunfallversicherung bezahlt, einfach einen Zusatz
mit einer Ausnahmeregelung hinzufügen, dass diese Verpflichtung bei
Verdacht auf sexuellen Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung und
anderen interpersonellen Traumata wie auch häuslicher Gewalt nicht gilt.
Nur dann hätten wir auch die Chance, ähnlich wie allen anderen
zivilisierten Ländern dieser Welt, über die medizinischen Daten einen
Überblick über das Ausmaß von traumatischen Belastungen in diesem
Bereich zu bekommen.
Ärzte Zeitung: Gibt es denn Daten, was dies die Kassen kosten könnte?
Fegert: Nein. Manchmal wirkt die widersprüchliche Situation in
Deutschland an diesem Punkt wie eine Realsatire der Bürokratie. Im
derzeit geplanten Abrechnungssystem sollen die Ärzte unterschiedliche
Formen der Misshandlung und des Missbrauchs mit den üblichen
internationalen Codes dokumentieren.
So sehen es die Vorgaben einer dem Gesundheitsministerium
nachgeordneten Behörde, des DIMDI, vor. Gleichzeitig gibt es, ebenfalls
von einer nachgeordneten Behörde des Ministeriums, dem INEK, eine
Kodierrichtlinie, die die Anwendung dieser Codes im Krankenhaus
verbietet.
Nun hat sich das Ministerium erfreulicherweise entschlossen, bei der
Vorbereitung der OPS-Codes für das nächste Jahr für die Abklärung von
Verdachtsfällen der Kindesmisshandlung, der Vernachlässigung und des
sexuellen Missbrauchs zum Beispiel in interdisziplinären Teams in
Kinderkliniken eine OPS-Ziffer einzuführen.
Aber auch diese dürften wegen der paradoxen Regelungen nicht verwendt
werden. Offensichtlich sind hier sich widersprechende, zum Teil gut
gemeinte Regelungen deutlich im Widerspruch zu dem, was das SGB V will.
Ärzte Zeitung: Mit welchen Folgen?
Fegert: In der Praxis führt dies dazu, dass die Ärzte, um
ihren Patienten nicht zu schaden, eher keine Angaben machen. Deshalb
befinden wir uns in Bezug auf schwere Misshandlung und Missbrauch im
Blindflug.
Es ist klar, dass diese Patienten in der Behandlung häufig mehr
Aufwand verursachen. Deshalb ist es sinnvoll, solche Faktoren in der
Abrechnung zu berücksichtigen. Dies darf aber für den Patienten nicht
die Folge haben, dass er sich einem Strafverfahren aussetzen muss, das
er nicht will und das ihm nicht gut tut.
Ärzte Zeitung: Was bleibt zu tun?
Fegert: Hier können eigentlich nur der Gesetzgeber und das
Bundesgesundheitsministerium den gordischen Knoten zerschlagen. Ein
Zusatz in Paragraf 294 a SGB V muss eingeführt werden, der die
angesprochene Ausnahme regelt. Dann könnten die Ärzte die vorgesehene
Kodierung zweifelsfrei anwenden.
Die Fragen stellte Anno Fricke
Lesen Sie dazu auch:
Missbrauch: Ärzte im Blindflug






 Een vriend trouwde en Seán Brady is duidelijk gemaakt dat clerical gatherings
are often characterised by dejection, depression and, sometimes, almost
despair, de idioot who cut down the cherry trees weet niet of hij nog wel priester kan blijven en ik zat ooit 3 dagen lang verbijsterd te kijken naar een man op dat balkon tegenover me, waarschijnlijk een inwoner van Moskou die blijkbaar wist wat je moest doen als je uitgenodigd was op een congres en daar al was het stoeltje nog zo fraai je geen pijn van in je kont en in je rug wilde krijgen en was blij met een piegempie van een jaar of 3 dat, toen er een vent brulde: willen we naar de Dam dan gáán we naar de Dam, op mijn schouders begon te springen waarmee ook ik snapte wanneer ik moest klappen
Een vriend trouwde en Seán Brady is duidelijk gemaakt dat clerical gatherings
are often characterised by dejection, depression and, sometimes, almost
despair, de idioot who cut down the cherry trees weet niet of hij nog wel priester kan blijven en ik zat ooit 3 dagen lang verbijsterd te kijken naar een man op dat balkon tegenover me, waarschijnlijk een inwoner van Moskou die blijkbaar wist wat je moest doen als je uitgenodigd was op een congres en daar al was het stoeltje nog zo fraai je geen pijn van in je kont en in je rug wilde krijgen en was blij met een piegempie van een jaar of 3 dat, toen er een vent brulde: willen we naar de Dam dan gáán we naar de Dam, op mijn schouders begon te springen waarmee ook ik snapte wanneer ik moest klappen Maren Ruden, Vertretung von Betroffenen
Maren Ruden, Vertretung von Betroffenen Ärzte Zeitung.de 22.10.2012
Ärzte Zeitung.de 22.10.2012 Da's nou nog 's een interessante procedure
Da's nou nog 's een interessante procedure 27 -10- 2012
27 -10- 2012 

 Gibney continued: “We play with the idea of silence in this film. How could this predatory behavior exist with people so helpless?
Gibney continued: “We play with the idea of silence in this film. How could this predatory behavior exist with people so helpless? Playboy Croatian priest's 'accomplice' arrested
Playboy Croatian priest's 'accomplice' arrested  She blackmailed him
She blackmailed him