Met dank aan NetzwerkB
Dtsch Arztebl 2013; 110(5): A-170 / B-156 / C-156
Es gibt eine verwirrende Vielzahl von Hilfsangeboten. Und dennoch bestehen Engpässe in der Traumatherapie. Institutionen tragen ein „strukturelles Risiko“.
Dtsch Arztebl 2013; 110(5): A-170 / B-156 / C-156
Es gibt eine verwirrende Vielzahl von Hilfsangeboten. Und dennoch bestehen Engpässe in der Traumatherapie. Institutionen tragen ein „strukturelles Risiko“.
Am 31. Dezember 2012 schaltete die katholische
Deutsche Bischofskonferenz ihre Hotline ab, bei der Opfer sexueller Gewalt
anrufen konnten. Es habe kaum noch Anrufe gegeben, hieß es. Eine am 17. Januar
vorgelegte Statistik der Hotline – mehr als 10 000 Kontakte innerhalb von zwei
Jahren – lässt das Ausmaß der Handlungen erahnen. Genaueres zum Missbrauch von
Abhängigen durch Geistliche sollte ein Forschungsprojekt zutage fördern, mit dem
der Kriminologe Prof. Dr. jur. Christian Pfeiffer betraut wurde. Der Vertrag
platzte am 9. Januar. Die gegenseitigen Vorwürfe lassen auf einen versteckten
Dissens schließen: Die Vertragspartner hatten sich in der Eile nicht genügend
über ihre jeweiligen Erwartungen und Möglichkeiten ausgetauscht. Vertane Zeit.
Dennoch. Die Gesamtbilanz der Bemühungen um
Aufarbeitung und Opferhilfe sieht so schlecht nicht aus, seit im Januar 2010
jener Brief bekanntwurde, der die Missbrauchsdebatte ins Rollen brachte. Der
Leiter des Canisius-Kollegs in Berlin, Jesuitenpater Klaus Mertes, hatte an mehr
als 600 Ehemalige geschrieben und vom systematischen sexuellen Missbrauch an
vielen Schülern berichtet. Nicht nur katholische Erziehungseinrichtungen waren
betroffen, wie sich herausstellte, doch blieben sie, neben der Odenwaldschule,
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Die Welle von immer neuen Offenbarungen, von
Empörung und Anschuldigungen führte dazu, dass die verantwortlichen
Institutionen gezwungen wurden, Missbrauch nicht insgeheim aufzuklären, sondern
strafrechtlich verfolgen zu lassen. Zugleich wurden die Opfer ermutigt, sich zu
melden, Therapien anzunehmen und Entschädigungen zu fordern.
Institutionell ist, wenn auch mit Abstrichen,
einiges geschehen:
1. Die
katholischen Bischöfe ernannten noch im Februar 2010 den Trierer Bischof, Dr.
Stephan Ackermann, zum Missbrauchsbeauftragten, gaben im August 2010 Leitlinien
zum Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger heraus und entschlossen sich
schließlich im März 2011 zu gewissen Entschädigungen. Stecken blieb hingegen die
unvoreingenommene Aufdeckung der die Missbräuche fördernden Strukturen.
2. Gleich drei Bundesministerinnen (für
Bildung, Familie und Justiz) versammelten im Frühjahr 2010 die Betroffenen um
einen „Runden Tisch“; dieser kam Ende 2011 mit einem Paket von Empfehlungen zum
Umgang mit Opfern, zur Intervention bei Verdachtsfällen und zur Prävention
heraus. Die freilich müssen noch umgesetzt werden.
3. Gleichzeitig etablierte die Bundesregierung
einen „unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“.
Dieser schließt seitdem unermüdlich mit den Dachverbänden von Heimträgern,
Kliniken und Jugendeinrichtungen freiwillige „Vereinbarungen“ zum Schutz von
Jugendlichen.
4. Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und
gesetzliche Krankenversicherung einigten sich im September 2012 auf eine
Rahmenempfehlung, um das Informationsangebot und die Versorgung von
Missbrauchsopfern zu verbessern (siehe DÄ, Heft 44/2012).
5. Bund
und Länder errichteten 2012 – nicht nur infolge der Missbrauchsdebatte, aber
durch sie vorangebracht – die beiden Fonds für Heimkinder West (dieser auch
gemeinsam mit den Kirchen) und Heimkinder Ost.
6. Ein
Netz von Anlauf- und Beratungsstellen entstand.
Defizite bei Prävention und Therapieangeboten
Die Missbrauchsdebatte förderte aber auch
erstaunliche Defizite zutage: in der Prävention, beim Umgang mit
Verdachtsfällen, bei der Zuwendung zu den Opfern, im Therapieangebot. Diese
wurden zwar angegangen, sind aber keineswegs behoben. Dem Betroffenen fällt es
immer noch schwer herauszufinden, welche Beratungsstelle für ihn zuständig, auf
welche Anspruchsgrundlage er seine Forderung nach Hilfe stützen kann oder
welcher Therapeut geeignet erscheint.
Wenn er überhaupt einen findet. Denn es gibt
erhebliche Versorgungslücken auf dem Land, für Behinderte und für Betroffene mit
Migrationshintergrund. Auch in der Stadt heißt es warten. Bei einem Workshop des
Traumanetzes Seelische Gesundheit zum Thema „Trauma und Institution“ im Dezember
2012 in Dresden wurden Wartezeiten von einem Jahr genannt. Wünschenswert sei
zudem, dass sich fortgebildete Traumatherapeuten der Missbrauchsopfer annähmen.
Nicht jeder Psychiater/Psychotherapeut sei gleich auch ein Traumatherapeut.
Ähnliches scheint, folgt man dem Workshop, auf psychiatrische Gutachter
zuzutreffen, die zum Beispiel bei Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz
eine ausschlaggebende Rolle spielen. Psychiatrische Gutachter schätzten
Traumatisierungen oft zu gering ein, bedauerte Dr. med. Julia Schellong von der
Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik in Dresden. Das sei
auch eine Frage der „Schulen“. Schellong sieht die Traumatherapie als noch
relativ junges, aber schon eigenständiges, wissenschaftlich fundiertes Fach an.
Sie gehört zu den Initiatoren des „Traumanetzes“, in dem Ärzte, Psychologische
Psychotherapeuten und weitere Gesundheits- und Sozialberufe vorwiegend aus
Sachsen zusammenarbeiten.
Eine gemischte Bilanz zog auf seiner
Jahrespressekonferenz in Berlin der Missbrauchsbeauftragte Johannes-Wilhelm
Rörig. Vor allem in der Prävention sei nicht genug erreicht. „Vordringlich
müssen die Spielräume der Täter eingegrenzt werden“, bekräftigte er bei dem
Dresdener Workshop. Vielen Institutionen scheine immer noch das
Problembewusstsein zu fehlen. Die Einstellung reiche vom Eingeständnis, man habe
das Problem „sträflich vernachlässigt“, bis zu: „Bei uns ist die Welt Gott sei
Dank noch in Ordnung“, zitierte Rörig Antworten aus einer Befragung bei circa
200 Einrichtungen aus dem Jahr 2012. Demnach haben 61 Prozent der befragten
Einrichtungen ein Präventionskonzept erarbeitet, eine Risikoanalyse nur 36
Prozent, von einem „Notfallplan“ bei Verdacht auf Missbrauch berichten 58
Prozent. Ein Musterstück an Hilflosigkeit lieferte im November 2012 die Berliner
Charité. Hier wurde ein Pfleger verdächtigt, sich Patientinnen gegenüber
auffällig verhalten zu haben. Der Fall ist bislang nicht vollständig geklärt.
Doch, um mit Rörig zu sprechen, „es war der Leitung nicht klar, was getan werden
muss, wenn ein Verdacht aufkommt“. Nun arbeite sie an einem Konzept. „Und ich
hoffe, dass die Charité nun zum Vorbild wird.“
Verlorenes Vertrauen, zögernde Wiedergutmachung
Die kindlichen und jugendlichen Opfer von
sexueller und anderer Gewalt stehen zumeist allein einer „Institution“
gegenüber. Diese neigt dazu, Anschuldigungen abzuwehren oder kleinzureden, ja,
sich selbst als Opfer der Täter zu sehen. Ein Lied davon kann der Jesuitenpater
Mertes singen, dem die Aufdeckung der Taten am Canisius-Kolleg keineswegs
gedankt wurde. Bei dem Dresdener Workshop berichtete er von spontaner Abwehr der
Kirchenoberen und von Anwürfen, die ihm entgegenschlugen. Die Institution
rutsche leicht ab „in das Jammern über die eigenen Schmerzen“. Das könne
geradezu in Hassgefühle gegenüber den Opfern wie den Aufklärern umschlagen. Doch
die Institution, hier die Kirche, müsse den Opfern Vertrauen entgegenbringen.
„Das wichtigste ist, die Opfer anzuhören“, betonte Mertes.
Prävention von Gewalt setzt Selbsterkenntnis
bei den Verantwortlichen voraus. Denn „Institutionen, in denen Mädchen und
Jungen leben und lernen, tragen ein strukturelles Risiko sexueller Gewalt“,
resümierte Christiane Hentschker-Bringt, eine Sozialpädagogin, die an Schulen
mit Kindern einübt, sich zu behaupten. Täter suchten sich bewusst oder unbewusst
solche Einrichtungen. Dabei geht es nicht allein um sexuelle, sondern auch um
körperliche und psychische Gewalt.
Gewalt jeder Art scheint in Heimen der DDR
verbreitet gewesen zu sein. Sie betraf weniger die sogenannten Normalheime als
die speziellen Einrichtungen für verhaltensauffällige Jugendliche, etwa die
Jugendwerkhöfe, insbesondere den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Ziel der
Einweisung sei Disziplinierung, Anpassung, ja Unterwerfung gewesen, berichtete
die Psychiaterin Ruth Ebbinghaus, Würzburg, auf der Dresdener Tagung. Sie
arbeitete 2011 bei einem Bericht über die DDR-Heimerziehung mit. Das sei durch
Kollektiverziehung, Drill und harte Strafen wie Essensentzug,
An-den-Pranger-Stellen, Arrest, vielfältige Gewalt durch Erzieher, erreicht
worden. Die Folgen seien überangepasstes wie auch aggressives oder
autoaggressives Verhalten, fehlende Selbstständigkeit oder auch die Unfähigkeit,
Hilfe anzunehmen. Wichtig für die Rehabilitation sei die offizielle Anerkennung
des erlittenen Unrechts und Leids. Eine materielle Entschädigung sei auch
psychisch wichtig. Entscheidend sei es, dass es den Betroffenen gelinge, aus der
Opferrolle herauszufinden. Es gelte, das persönlich erlittene Unrecht als
gesellschaftlich verursacht anzusehen. Es gebe freilich bisher keine speziellen
Konzepte für die Behandlung komplexer Traumatisierungen.
Norbert Jachertz
Anspruchsgrundlagen
Nach dem Opferentschädigungsgesetz haben Opfer eines
„tätlichen Angriffs“, der sich nach dem 15. Mai 1976 (alte Bundesländer) oder 2.
Oktober 1990 (neue Bundesländer) zugetragen hat, Anspruch auf Heilbehandlung und
Rehabilitation nach dem Bundesversorgungsgesetz. Sexueller Missbrauch wird als
tätlicher Angriff gewertet.
Heimkinder aus den alten Bundesländern, die
zwischen 1949 und 1975 in Heimen waren, können durch den Fonds Heimerziehung West, der von Bund,
West-Ländern und Kirchen getragen wird, entschädigt werden (Anträge bis 31.
Dezember 2014). Heimkinder aus den neuen Bundesländern, die zwischen 1949 und
1990 in DDR-Heimen waren, können Entschädigungen aus dem Fonds Heimerziehung Ost erhalten, der von Bund
und Ost-Ländern getragen wird (Anträge bis 30. Juni 2016).
Beide Fonds prüfen zunächst die Berechtigung
und schließen sodann mit den Antragstellern individuelle Vereinbarungen über materielle,
medizinische oder psychotherapeutische Leistungen ab. Betroffene, die
zwangsweise in DDR-Heime eingewiesen waren, insbesondere in den geschlossenen
Jugendwerkhof Torgau, können zudem nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz auch
Ansprüche auf finanzielle Leistungen haben.
Die katholischen Bistümer vergüten bis zu 50
Sitzungen bei einem approbierten Psychotherapeuten (bei Paarbetreuung 25
Sitzungen) und zahlen außerdem eine Art Schmerzensgeld von bis zu 5 000
Euro.



















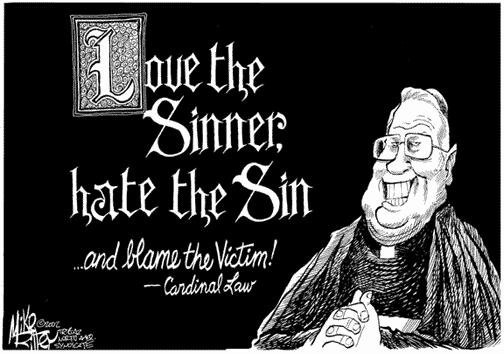
Geen opmerkingen:
Een reactie posten