Lombardi
Hin und wieder aber begegnen mir in Russland Bärte, die alles in den Schatten stellen, was ich anderswo an Bärten gesehen habe.
Vater Jewstafij schlug sie alle. Sein Bart kannte keine Grenzen, er wucherte dem Priester aus allen Poren, ein weißblondes Dickicht ohne Anfang und Ende. Wenn Vater Jewstafij wütend war, und er neigte zur Wut, dann flackerte Zornesröte durch den erkennbaren Teil seines Gesichts – er sah in solchen Momenten aus wie ein brennender Heuschober.
Rüde schob er mich durch den Flur seiner Wohnung und stieß die Tür zum Arbeitszimmer auf.
„Da!“, schrie er. „Da haben Sie, wonach Sie gesucht haben!“
Er zeigte auf eine Ikone, die an der gegenüberliegenden Wand hing.
Fassungslos näherte ich mich dem Bild. Vater Jewstafij trat neben mich. Obwohl ich seinen Mund nicht sehen konnte, spürte ich, dass er grinste. Er genoss meine Sprachlosigkeit.
„Und?“, fragte er höhnisch. „Gefällt sie Ihnen?“
Er kannte die Antwort. Sie gefiel mir nicht, sie konnte mir nicht gefallen. Ein gespenstisch vertrautes Gesicht, kaltschnäuzig und schnauzbärtig, dominierte das Heiligenbild: Stalin, Lenker und Henker der Völker.
Die Ikone hatte Vater Jewstafij seine Gemeinde gekostet. Bis vor ein paar Jahren war er der Vorsteher einer kleinen Kirche am Stadtrand von Sankt Petersburg gewesen. Es war eine ganz normale Kirche, mit ganz normalen Kirchgängern, die vor ganz normalen Heiligenbildern ihre Kreuze schlugen. Bis eines Tages ein altes Mütterchen schreiend aus der Kirche gerannt kam, weil die Frau plötzlich gemerkt hatte, dass sie ihre Kreuze vor einem schnauzbärtigen Scheinheiligen schlug. Das Geschrei drang bis zum Bischof vor, und Vater Jewstafij, der die Ikone aufgehängt hatte, durfte seinen Rücktritt einreichen. Seitdem hing das Bild in seiner Wohnung, im Stadtzentrum von Sankt Petersburg.
„Aber warum...?“, setzte ich an. Die ganze Idee war absurd. Gut, Stalin hatte ein Priesterseminar besucht, bevor Marx in sein Leben trat. Nach der Revolution aber hatte er sein Bestes getan, um die Russisch-Orthodoxe Kirche auszulöschen, zu Tausenden waren die Priester hingerichtet worden. Dass die Kirche überhaupt noch existierte, war ein Wunder. Warum sollten die Orthodoxen nun ihren eigenen Henker anbeten?
Alles ein Missverständnis, wie Vater Jewstafij mir erklärte. Nie hatte Stalin vorgehabt, die Kirche zu vernichten, im Gegenteil – er hatte sie gerettet. Nach Lenins Tod hatte er systematisch die alte Führungsriege der Bolschewiken ermorden lassen, bis nur er allein übrig blieb – mit dem einzigen Ziel, die kommunistische Kirchenverfolgung zu stoppen.
Zugegeben, um seine wahren Absichten zu verschleiern, hatte Stalin auch ein paar Priester opfern müssen. „Aber die sind jetzt alle im Himmel“, versicherte mir Vater Jewstafij. „Kein Land hat so viele Märtyrer wie Russland, keins hat so viele Fürsprecher bei Gott. Wir müssen Stalin dankbar sein!“
Entgeistert formulierte ich Einwände, aber wir fanden keine gemeinsame Sprache. Nach zwei Stunden verließ ich Vater Jewstafijs Wohnung mit dem Gefühl, selten in eine widersprüchlichere Gedankenwelt hineingesehen zu haben.
Nachts träumte ich von Bärten. Von Stalinbärten, Leninbärten, Dostojewskijbärten, Solschenizynbärten, von Zarenbärten und Rasputinbärten, von Marx- und Engelsbärten, von Priesterbärten, Heiligenbärten und Väterchen-Frost-Bärten. Als ich aufwachte, rasierte ich mich gründlich.
Jens Mühling.
bron: Der Tagesspiegel



















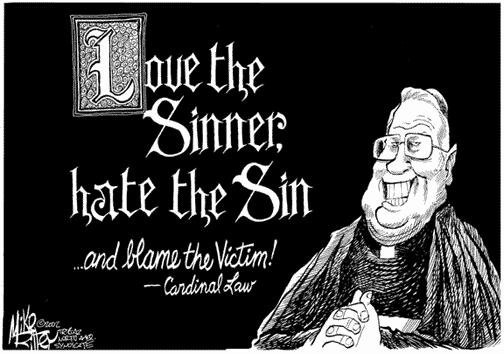
Geen opmerkingen:
Een reactie posten